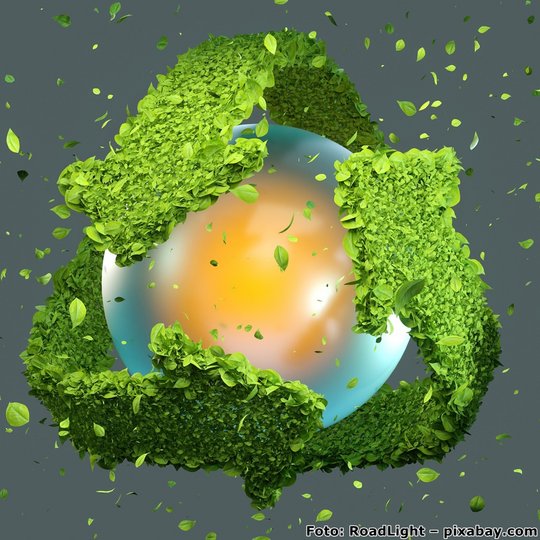Vor dem Hintergrund des politischen Willens zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in der Europäischen Union gibt die EU im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und der darin definierten Ziele Richtlinien vor. Diese Richtlinien sollen von den Mitgliedstaaten durch nationale Gesetzgebungen und Förderinitiativen umgesetzt werden. Ziel ist es, auf diesem Wege bereits bestehende gesellschaftliche Vorstellungen im Bereich Nachhaltigkeit zu stärken und durch konkrete Maßnahmen weiter umzusetzen. Ein anschauliches Beispiel für eine solche richtliniengestützte Förderung ist das Konzept der Kreislaufwirtschaft.
Wie lassen sich Ziele der Nachhaltigkeit auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene umsetzen? Die europäischen Vorgaben und deren Umsetzung auf nationaler Ebene betreffen die Menschen in der EU unmittelbar – sie haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Bürgerinnen und Bürger. In dieser Unterrichtseinheit sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen und erfahren, dass diese Richtlinien und Gesetze dem übergeordneten Ziel einer nachhaltigen Entwicklung dienen, das als gemeinsames gesellschaftliches Leitbild angestrebt wird.
Im Zentrum der Unterrichtseinheit steht das regenerative System der Kreislaufwirtschaft. Die Lernenden setzen sich mit den theoretischen Grundlagen sowie den praktischen Auswirkungen dieses Konzepts auseinander. Sie erarbeiten, wie Maßnahmen und Zielsetzungen der EU auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene umgesetzt werden und welche Bedeutung und Auswirkungen dies direkt und indirekt auf die eigene Lebenswelt hat. Dabei stehen folgende Leitfragen im Fokus:
- Wie beeinflussen EU-Regelungen die Akteure vor Ort?
- In welchem Maße wirken sich diese Regelungen auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wirtschaftslebens (Verbraucherinnen und Verbraucher, Betriebe etc.) aus?
- Wie betreffen die Vorgaben die Lernenden persönlich in ihrem Alltag?
- Wo lassen sich die Auswirkungen europäischer und nationaler Regelungen im eigenen Umfeld beobachten?
Um diese Fragen greifbar zu machen, wird in der Unterrichtseinheit ein lebensnahes Lernfeld eröffnet. Die Lebenswelt der Lernenden wird dabei bewusst mit dem Wirtschaftssektor Handwerk verknüpft, um die Verbindung zwischen den Lernenden als Verbraucherinnen und Verbrauchern und den Akteuren herzustellen, die die politischen Vorgaben konkret umsetzen und mitgestalten.
Anhand konkreter Beispiele aus dem Umfeld der Schülerinnen und Schüler – wie etwa Reparaturwerkstätten, Elektrofachbetriebe, aber auch Bäckereien, Fleischereien oder Konditoreien – wird exemplarisch deutlich, wie diese Betriebe zur Umsetzung europäischer Nachhaltigkeitsziele beitragen. Gleichzeitig werden erste Einblicke vermittelt, an welchen Stellen die europäische Strategie zur Kreislaufwirtschaft an ihre Grenzen stößt.
Mithilfe der zugehörigen Arbeitsmaterialien wird der Nutzen von Reparaturen für die Kreislaufwirtschaft thematisiert. Abschließend wird im letzten Arbeitsblatt der Mehrweg-Gedanke als zentrales Element der Kreislaufwirtschaft behandelt, um die Möglichkeiten zur Abfallvermeidung aufzuzeigen.