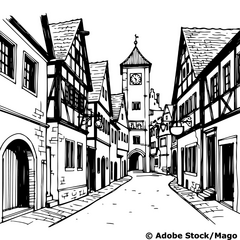Bauen in der Geschichte
Unterrichtseinheit
Die Unterrichtseinheit für das Fach Geschichte der Klassen 9–10 vermittelt den Schülerinnen und Schülern historische Entwicklungsprozesse am Beispiel der Baugeschichte. Sie erkunden, wie sich Bautechniken und Materialien durch verschiedene Epochen und unter sich wandelnden Bedingungen veränderten, wobei der Gerüstbau als zentrale Hilfskonstruktion im Fokus steht. Durch Recherche und Projektarbeit erstellen sie Zeitleisten, entwickeln Steckbriefe und schlüpfen in historische Rollen. Diese Unterrichtseinheit bietet einen kurzen Einblick in die Baugeschichte und verdeutlicht, wie sich Bauen im Laufe der Zeit durch verschiedene Herausforderungen und Innovationen verändert hat. Die Einheit beginnt mit einer kompakten Einführung ( Arbeitsblatt 1 ) in die Baugeschichte, wobei das Gerüst als zentrale Hilfskonstruktion, die Bauen erst ermöglicht, im Fokus steht. Die Schülerinnen und Schüler erkennen dabei, wie unter anderem der Gerüstbau den Fortschritt im Bauwesen ermöglichte und wie komplex es ist, Baugeschichte als eine zusammenhängende Entwicklung darzustellen. Sie erfahren, welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ursachen zu Veränderungen führten und warum Krisen oftmals Veränderungen in der Baugeschichte markierten. In Arbeitsblatt 2 wird der Gerüstbau als tragendes Element der Baukunst genauer untersucht. Die Bedeutung von Gerüsten als "Stützen der Baukunst“ wird herausgearbeitet und anhand des Brückenbaus symbolisch verdeutlicht. Dabei entdecken die Schülerinnen und Schüler, inwiefern Bauwerke wie Brücken eng mit Macht und Handel verbunden sind und welche baulichen Anforderungen für ihre Errichtung notwendig waren. Sie setzen sich auch mit den verschiedenen Materialien auseinander, die im Laufe der Zeit verwendet wurden, und verstehen, wie Materialinnovationen zu veränderten Bauweisen und neuen architektonischen Möglichkeiten führten. Mithilfe des Arbeitsblatts 3 wenden die Schülerinnen und Schüler ihr erworbenes Wissen in einem praktischen Projekt an. Sie recherchieren zu verschiedenen Bauwerken, erstellen Steckbriefe und ordnen chronologische Eckdaten zu. Im Perspektivwechsel schlüpfen sie dann in die Rolle einer Baumeisterin oder eines Baumeisters einer bestimmten Epoche. Aus dieser Sicht interpretieren und verteidigen sie ihre vorher erarbeiteten Bauentscheidungen und setzen sich spielerisch mit den historischen und technischen Bedingungen auseinander, unter denen große Bauwerke entstanden. Dieser kreative Zugang ermöglicht ein Verständnis für die Entwicklung der Baugeschichte, den Umgang mit Ressourcen und die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Bauwesen. Die Arbeitsblätter dienen dazu, sich mit geschichtlichen Prozessen auseinanderzusetzen. Es gilt zu verstehen, dass geschichtliche Abläufe sich gegenseitig bedingen und zusammenhängen. Vorgänge werden anhand der Baugeschichte mit Sachbezug zum Gerüstbauer-Handwerk veranschaulicht. Die Unterrichtseinheit bietet insbesondere Einblicke in die Entwicklung des Bauwesens und zeigt auf, wie Baumeister/innen früherer Epochen mit Materialien, Herausforderungen und begrenzten Ressourcen umgingen. So erhalten die Lernenden einen praktischen Einblick in die Überlegungen der damaligen Zeit. Das Thema vermittelt außerdem, wie sich Wissen über die Zeit entwickelt und teilweise wiederentdeckt wurde, was wesentlich zum Verständnis von Kultur- und Technikgeschichte beiträgt. Diese Inhalte fördern nicht nur die Fähigkeit zur systematischen Recherche, sondern regen die kritische Auseinandersetzung mit historischen Prozessen an, die bis heute Bauweisen und Architektur beeinflussen. Damit die Lernenden den Inhalt gut erfassen können, sollten sie bereits einige Vorkenntnisse zu historischen Epochen wie dem Mittelalter, der Renaissance und dem Industriezeitalter besitzen. Grundlegendes Wissen über bedeutende Bauwerke und deren kulturelle Hintergründe sowie ein grundlegendes Verständnis der Eigenschaften unterschiedlicher Materialien (etwa die Unterschiede zwischen Holz, Stein und Stahl ) sind ebenfalls hilfreich. Die didaktisch-methodische Gestaltung der Einheit zielt darauf ab, dass die Schülerinnen und Schüler die Entwicklung des Bauwesens nachvollziehen und die Rolle von Gerüsten beim Bau von Bauwerken verstehen. Sie schlüpfen in die Rolle von Historikerinnen und Historikern sowie Baumeisterinnen und Baumeistern und lernen, wie wichtig systematische Recherche, Datenaufbereitung und Präsentation ihrer Erkenntnisse sind. Der Einsatz von forschendem Lernen, bei dem die Lernenden eigenständig oder in Kleingruppen Bauwerke recherchieren und Steckbriefe sowie Zeitleisten erstellen, stärkt ihre analytischen und kreativen Fähigkeiten. Die abschließende Aufgabe, eine eigene Vorstellung des historischen Gerüstbaus zu entwerfen, vertieft ihr Verständnis für die baulichen und technischen Herausforderungen verschiedener Zeiten. Der Unterrichtsabschluss erfolgt mit einer Präsentation in Form eines Museumsrundgangs und einer Gruppenpräsentation. Eine abschließende Reflexionsrunde bietet den Lernenden Raum, über die gelernten Inhalte nachzudenken und neue, offene Fragen zu formulieren, die gegebenenfalls in künftigen Unterrichtseinheiten vertieft werden können. Zur Vorbereitung der Unterrichtseinheit können verschiedene Ressourcen bereitgestellt werden, die die Lernenden bei der Recherche unterstützen. Dazu gehören Webseiten oder Bilder von Bauwerken aus unterschiedlichen Epochen. Bildmaterial von historischen Bauwerken und Baustellen, die Gerüste zeigen, kann den Unterricht zusätzlich veranschaulichen. Falls möglich, können auch Modelle oder Materialproben (zum Beispiel von Holz oder Metall) die Unterschiede der Baustoffe verdeutlichen. Für den Museumsrundgang sollte der Klassenraum so gestaltet werden, dass die Lernenden ihre Arbeiten gut präsentieren können. Fachkompetenz Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Verständnis für die bautechnischen Gegebenheiten und Herausforderungen historischer Bauwerke. analysieren die Rolle von Gerüsten in verschiedenen Bauprojektarten und reflektieren deren Bedeutung für den Fortschritt der Baukunst. erhalten eine Übersicht über die historische Entwicklung im Gerüstbau und wiederholen die verschiedenen Zeitepochen. erstellen einen Zeitstrahl bzw. chronologische Darstellungen, um die Entwicklung des Gerüstbaus und dessen historische Kontexte anschaulich zu visualisieren. Medienkompetenz Die Schülerinnen und Schüler entwickeln die Fähigkeit zur Quellenkritik, indem sie verschiedene Quellen bewerten und deren Glaubwürdigkeit, Relevanz und Objektivität analysieren. sammeln und strukturieren Informationen, vergleichen und analysieren diese kritisch. nutzen interdisziplinäres Denken, um ein umfassenderes Bild der historischen Bedeutung von Bauwerken zu erhalten. dokumentieren und bereiten die beschafften Informationen auf, verteidigen und begründen ihre eigenen Annahmen und Argumente, sei es in schriftlicher Form, durch Präsentationen oder digitale Formate. erarbeiten eigene Projekte, beispielsweise in Form von Steckbriefen, und erstellen Präsentationen. Sozialkompetenz Die Schülerinnen und Schüler lernen, sich arbeitsteilig zu organisieren. verbessern ihre Kommunikationsfähigkeit, indem sie gemeinsam über Ideen in Gruppen- und Paararbeit diskutieren. Verwendete Literatur: Jeromin, Wolf (2017): Gerüste und Schalungen im konstruktiven Ingenieurbau, 1. Auflage, Wiesba-den: Springer Vieweg. Holzer, S. M. (2021). Gerüste und Hilfskonstruktionen im historischen Baubetrieb: Geheimnisse der Bautechnikgeschichte. Weinheim: VCH. Meiners, Uwe ; Ziessow, Karl-Heinz (Hrsg.) (2000): Dinge und Menschen. Geschichte, Sachkultur, Museologie. Beiträge des Kolloquiums zum 65. Geburtstag von Helmut Ottenjann. Cloppenburg: Mu-seumsdorf, S. 17-28.
- Geschichte
- Sekundarstufe I