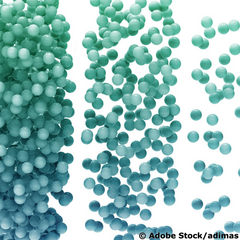Energieumwandlung im Hybridmotor
Unterrichtseinheit
Die Unterrichtseinheit für das Fach Physik der Klasse 10 zeigt auf, wie der Hybridmotor elektrische und mechanische Energie kombiniert. Die Schülerinnen und Schüler untersuchen Aufbau und Funktionsweise des Hybridantriebs, analysieren Energieumwandlung und Energieerhaltung und vergleichen unterschiedliche Antriebssysteme. Interaktive Aufgaben, Animationen und ein Rollenspiel fördern das Verständnis moderner Fahrzeugtechnik. Was bedeutet es, Vorteile aus zwei Motorenarten zu kombinieren, um Vorteile für technische Entwicklungen zu erzielen? Wie kann man verschiedene physikalische Prozesse gleichzeitig nutzen, um die Effizienz zu steigern? Mit diesen und verwandten Fragen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler anhand von drei Arbeitsblättern in dieser Unterrichtseinheit. Es geht darum, sich mit dem Hybridantrieb auseinanderzusetzen und herauszufinden, warum er das Beste aus zwei Welten vereint. Ziel der Unterrichtseinheit ist es, diese Antriebsart kennenzulernen und mit anderen Antriebsarten zu vergleichen. Es ist sinnvoll, die Unterrichtseinheiten zum Verbrennungsmotor und zum Elektromotor vorzuschalten. In der ersten Stunde nähern sich die Schülerinnen und Schüler der Frage, welche beiden Antriebsarten im Hybridauto vereint sind. Sie erarbeiten, welche Technik welche Funktion erfüllt und lernen dabei, zwischen Energiespeicher und Energiewandler zu unterscheiden. Anschließend bestimmen sie anhand vorgegebener Kriterien Merkmale von Verbrenner-, Elektro-, und Hybridautos. Die Lernenden recherchieren selbstständig ein Hybridmodell, überprüfen die erarbeiteten Merkmale des Hybridfahrzeugs und nehmen eine Einordnung und Unterteilung vor. Darauf aufbauend lernen sie den Aufbau und die Funktionsweise eines Hybridantriebs kennen. Die Lernenden setzen sich mit den Antriebskomponenten auseinander, indem sie einen Lückentext ausfüllen. Anhand von zwei Abbildungen erarbeiten sie die Unterschiede zwischen Elektro- und Hybridantrieb. Mit diesem Wissen erarbeiten die Lernenden anhand einer Animation zum Energiefluss eines Hybridautos die Vorgänge in den verschiedenen Betriebsphasen. Sie erarbeiten, welcher Motor in welcher Betriebsphase zum Einsatz kommt und warum und wie die Energieumwandlung funktioniert. Optional wird eine Zusatzaufgabe angeboten. Die Lernenden werden aufgefordert, die Infrastruktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge aktiv wahrzunehmen. Dazu recherchieren sie in ihrem schulischen Umfeld Tankstellen, Ladesäulen und Werkstätten, die auf Elektro- und Hybridfahrzeuge spezialisiert sind und lernen verschiedene Recherchemöglichkeiten kennen. Die Lernenden vertiefen zudem ihr erworbenes Wissen über Energieumwandlung und Energieerhaltung. Dazu lesen sie einen kurzen Informationstext über die physikalischen Grundlagen, die verschiedenen Energieformen und die Energieumwandlung in einem Hybridauto. Das erworbene Wissen fassen sie zusammen, indem sie Beispiele zur Energieumwandlung sammeln. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Energierückgewinnung durch Rekuperation kennen und erarbeiten die Funktionsweise anhand eines Videos, das den Vorgang zielgruppengerecht veranschaulicht. Es folgt ein Quiz zum Hybridantrieb, das die wichtigsten Inhalte spielerisch abfragt. Das Quiz kann in Kahoot erstellt werden, um den Spaßfaktor, die Motivation und die Interaktivität zu erhöhen. Die Einheit endet mit einem Rollenspiel, in dem die Lernenden ein Beratungsgespräch simulieren. Indem die Lernenden einem fiktiven Kunden/einer fiktiven Kundin die Funktionsweise des Hybridfahrzeugs, den Unterschied zwischen den Antriebsarten und den Vergleich zum Elektroauto erklären und die Vor- und Nachteile des Hybrids erläutern, übertragen sie das erworbene Wissen auf eine konkrete Situation. Die Aufgabe verdeutlicht das vielfältige Wissen, das für ein solches Beratungsgespräch im Kfz-Gewerbe erforderlich ist. Die Reflexion des Gelernten, der Unsicherheiten und Herausforderungen während des Rollenspiels kann als Ausgangspunkt für die Wiederholung und Vertiefung der Inhalte mit der Lerngruppe dienen. Verschiedene Autos mit unterschiedlichen Antriebsarten sehen die Schülerinnen und Schüler jeden Tag, beispielsweise auf dem Weg zur Schule. Dabei nehmen sie von außen oft keine offensichtlichen Unterschiede wahr. Die Unterrichtseinheit zum Hybridantrieb ist darauf ausgelegt, dieses alltägliche Phänomen zu durchleuchten und den Lernenden ein tiefergehendes Verständnis für die Antriebsart (Hybrid) zu vermitteln. Vor dieser Unterrichtseinheit sollten die Grundlagen des Verbrennungsmotors und des Elektromotors sowie deren Funktionsweise und Aufbau behandelt worden sein. Sie richtet sich an Lernende, die ein grundlegendes Verständnis dieser Antriebsarten mitbringen. Von Vorteil ist ebenfalls Grundlagenwissen über Energiearten, Energieumwandlung und Energiespeicherung. Diese Vorkenntnisse bilden die Basis für das Verständnis der Vorteile eines Hybridantriebs, der als Synthese der besten Eigenschaften beider Welten gilt. Um die komplexen Vorgänge des Hybridantriebs verständlich zu machen, wurden die Inhalte didaktisch reduziert aufbereitet. Beispielsweise wurden lediglich die wesentlichen Energiewandlungsprozesse eingeführt. Hierbei spielen vor allem die Begriffe "mechanische", "elektrische" und "chemische" Energie eine zentrale Rolle. Unterkategorien wie "kinetische Energie" und "potenzielle Energie" werden zwar erwähnt, aber nur oberflächlich behandelt, insbesondere die Lageenergie (potenzielle Energie) wird nicht detailliert vertieft. Komplexe Vorgänge werden stets durch eine Abbildung, eine Animation oder ein Video veranschaulicht, um das Thema auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen zugänglich zu machen und das Verständnis zu unterstützen. Differenzierte Aufgabenstellungen mit variierenden Schwierigkeitsgraden ermöglichen es allen Schülerinnen und Schülern, die Inhalte auf ihrem individuellen Niveau zu erschließen. Hilfestellungen wie Tipp-Boxen und veranschaulichende Grafiken unterstützen dabei das Lernen und Verstehen, während Wort-Kästen das Leseverständnis fördern und bei der Erschließung unbekannter Begriffe helfen. Die Unterrichtseinheit bedient sich einer Vielfalt an Medienformaten wie Videos, interaktiven Karten und Texten mit Vorlesefunktion, um unterschiedliche Lerntypen anzusprechen. Diese multimediale Herangehensweise ermöglicht es den Lernenden, die Informationen auf vielfältige Weise aufzunehmen und zu verarbeiten. Sie fördert individuelles Lernen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Lehrinhalten. Ein Schwerpunkt der Unterrichtseinheit ist das forschend-entdeckende Lernen. Neben der Vermittlung theoretischer Grundlagen bieten Erkundungsaufgaben direkte Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Die Erforschung der Infrastruktur für Hybridfahrzeuge in ihrer eigenen Region schafft einen konkreten Realitätsbezug. Durch den konkreten Bezug zum Kfz-Gewerbe wird ein Bewusstsein für die eigene Umwelt geschaffen. Die praxisnahen Aufgaben stärken die Selbstständigkeit und das kritische Denken der Lernenden. Die Unterrichtseinheit bietet zahlreiche gesellschaftswissenschaftliche Bezüge. Die Analyse des Schadstoffausstoßes verschiedener Fahrzeugtypen ermöglicht Diskussionen über aktuelle Gesetzgebungen, den Ausbau der Infrastruktur und Bemühungen zur Schadstoffreduktion im Kfz-Gewerbe. Eine vertiefende Einheit zur Nachhaltigkeit im Verkehrssektor kann fachübergreifende Zusammenhänge verdeutlichen. Durch Gruppen- und Paararbeit wird die Zusammenarbeit unter den Schülerinnen und Schülern gefördert. Sie können ihr Wissen austauschen, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam Aufgaben erarbeiten. Diese kooperativen Lernformen stärken soziale Kompetenzen und fördern die Teamarbeit der Lerngruppe. Ein abschließendes Rollenspiel stellt einen praktischen Anwendungsbezug her, indem die Lernenden als Beraterinnen und Berater in einem fiktiven Beratungsgespräch die Funktionsweise und Vorteile eines Hybridfahrzeugs erläutern. Die Reflexion über ihre Erfahrungen während des Rollenspiels dient als Ausgangspunkt für eine vertiefte Wiederholung und Festigung der erlernten Inhalte. Fachkompetenz Die Schülerinnen und Schüler lernen Aufbau und Funktionsweise eines Hybridantriebs kennen. unterscheiden zwischen Energiespeichern und Energiewandlern. verstehen, warum Hybridmotoren effizient sind. lernen die verschiedenen Arten der Energieumwandlung mit Sachbezug zum Hybridauto kennen. beziehen die verschiedenen Energiearten (elektrische, chemische und thermische Energie) auf den Energiefluss und die Energieumwandlung im Hybridfahrzeug. lernen die Rekuperation im Zusammenhang mit dem Elektroantrieb kennen. vergleichen die verschiedenen Antriebsarten (Verbrennungsmotor, Elektroantrieb, Hybridantrieb) hinsichtlich der physikalischen Vorgänge. Medienkompetenz Die Schülerinnen und Schüler gewinnen Informationen aus verschiedenen Medien wie Text, Video, Webseiten und interaktiven Grafiken. recherchieren selbstständig im Internet nach genannten Kriterien und Informationen und lernen, die recherchierten Informationen zu selektieren. lernen, recherchierte Informationen zu präsentieren. Sozialkompetenz Die Schülerinnen und Schüler hören zu und erkennen relevante Informationen zu einer bestimmten Fragestellung. arbeiten kooperativ in Zweiergruppen und in Kleingruppen. führen eine Pro-und-Contra-Diskussion und lernen, eigene Standpunkte zu vertreten sowie fremde Standpunkte zu akzeptieren. übertragen die gesammelten Informationen in ein Rollenspiel und lernen, Informationen zielgruppengerecht zu vermitteln. setzen sich im Zusammenhang mit dem Thema aktiv mit ihrer Umgebung auseinander.